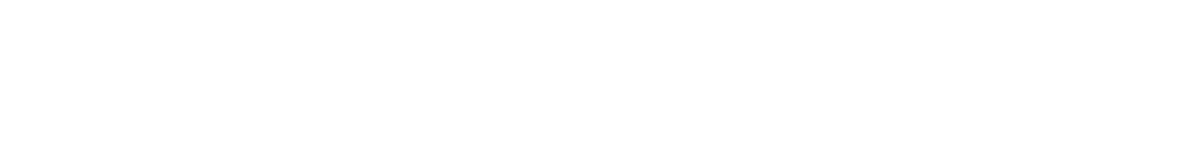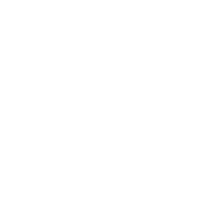The Commissions
«Jürg Stäuble &
Hannah Villiger»
1. bis 9. Dezember 2018
Eröffnung: 30. November ab 17:30
Kuratiert von Roman Kurzmeyer
Zu sehen sind in dieser Ausstellung von Jürg Stäuble und Hannah Villiger drei Werke. Es ist eine kurze Reise in eine Vergangenheit, die von Liebe und Freundschaft, vor allem aber von einem in den späten 1970er-Jahren neu erwachten Interesse an Skulptur und Körperlichkeit handelt. Jürg Stäuble zeigt in einer Wiederaufführung im Ausstellungsraum der TANK seine erstmals 1979 in der Galerie Per Sten in Kopenhagen ausgestellte Installation Seifen-Raum. Seither war die Arbeit 1986 in einem Glashaus der Alten Stadtgärtnerei in Basel sowie 1994 in der ersten Retrospektive des Künstlers im Aargauer Kunsthaus in Aarau wieder ausgestellt. Von der 1997 jung verstorbenen Hannah Villiger sind zwei Arbeiten zu sehen, die sie Jürg Stäuble geschenkt hat, und die sich seither in der Sammlung des Künstlers befinden. Es sind Aufnahmen von ihrem Körper mit einer Polaroidkamera. Skulptural (1984/85) ist die Vergrösserung eines Polaroids über ein Internegativ auf Colornegativpapier im Format 125 x 123 cm. Das zweite Werk, Skulptural (1993), ist eine aus vier nicht vergrösserten Polaroids bestehende Skizze für eine mehrteilige Arbeit. Hannah Villiger und Jürg Stäuble unterrichteten beide an der Fachklasse für freies räumliches Gestalten der Schule für Gestaltung in Basel, Stäuble seit 1988 als deren Leiter und Villiger von 1992 bis 1996 als Dozentin. Kennengelernt hatten sie sich schon in den frühen 1970er-Jahren an einer Ausstellungseröffnung im Aargauer Kunsthaus in Aarau. 1973 reiste Stäuble mit einem Canada Council Grant für ein Jahr nach Kanada. Im Sommer 1974, nach Abschluss ihres Studiums an der Kunstgewerbeschule Luzern, brach auch Hannah Villiger nach Kanada auf, wo sie in Toronto zusammen mit Jürg Stäuble vor Ort entstandene Arbeiten in einer gemeinsamen Ausstellung zeigen konnte.
Jürg Stäuble hatte in den 1970er-Jahren erste installative Werke geschaffen und dabei mit Materialien experimentiert, die für sein am Minimalismus orientiertes damaliges Schaffen neu waren. Make-up, das auf Spiegel aufgetragen wurde, oder Seifen, deren Parfum in der Ausstellung genauso wichtig war wie deren Form, Funktion und Farbigkeit. Der Seifen-Raum entstand in einer Zeit des Umbruchs, die eine im Schaffen bis heute interessant gebliebene Zäsur bildet, auf die unsere Ausstellung hinweisen möchte. Beat Wismer, der zusammen mit Heide Hölscher, Silvia Bächli und Eric Hattan 1981 den Ausstellungsraum Filiale in Basel gründete und später während vieler Jahre das Aargauer Kunsthaus leiten sollte, spricht 1994 im Katalog «Jürg Stäuble. Werke 1971-1994» treffend von einer «Zeit der Versinnlichung der Arbeit». Die Filiale war ein für die lokale Kunstszene Basels und deren Handhabung raumbezogener Arbeiten prägender Offspace, der den Künstlern die Produktion und Diskussion neuer Arbeiten ermöglichte. Die Installation Seifen-Raum besteht aus rosafarbenen Seifen, die unregelmässig und weiträumig auf dem Boden des Ausstellungsraums verteilt sind und einer, auf den ausgelegten Seifen an einer Stelle aufliegenden Platte aus Milchglas, die in den früheren Fassungen je nach Raumgrösse unterschiedlich dimensioniert war. Die Arbeit wecke «Assoziationen an eingeseifte Körper hinter weich zeichnendem Duschvorhang», schreibt Beat Wismer in der schon erwähnten Werkeinführung.
Die erste Fotoarbeit von Hannah Villiger stammt von 1975, zuvor befasste sich die junge Bildhauerin mit der handwerklichen Transformation von Material in Kunst. Nun fotografierte sie diese Arbeiten wie rituelle Objekte. Die Bilder zeigen brennende, in die Luft geworfene Palmblätter, geschälte Äste, in den Himmel schiessende Wasserfontänen oder auf dem sandigen Boden aufschlagende Bocciakugeln. Um 1980 verlagerte sich ihr Interesse auf den menschlichen Körper. Hannah Villiger wird nun fast ausschliesslich Teilansichten ihres eigenen, meist nackten Körpers in unterschiedlichen Stellungen und aus verschiedenen Perspektiven mit einer Polaroidkamera fotografieren. Die Arbeiten entstehen in ihrer Wohnung auf einer kleinen Matratze. Diese Fotografien nannte sie «Skulptural», die Präsentation ihrer Bilder im Raum, somit die Ausstellung ihrer Werke, bezeichnete sie als «Skulptur». Der Raumbezug ihrer Arbeiten war sowohl für Hannah Villiger als auch für Jürg Stäuble von Bedeutung. Während Stäuble jedoch Objekte im Raum visuell erfahrbar machte und mit der Zeit der Wahrnehmung eine vierte Dimension ins Spiel bringt, arbeitete Villiger vorwiegend mit den zwei Dimensionen der Fotografie. «Bei meiner Arbeit ist die Räumlichkeit und die Plastizität des Körpers im Bild selber viel stärker vorhanden», sagt Villiger 1996 in einem Gespräch mit Miriam Cahn zu ihrer künstlerisch unterschiedlichen Auffassung von Raum, «ich arbeite bewusst an dieser Räumlichkeit.» Nicht die Entgrenzung des Werkbegriffs und der Einbezug des Betrachters in die Struktur des Werkes, wie dies seit den späten 1960er-Jahren für installatives Schaffen die Regel war und von Michael Fried in seinem damals bekannten und kontrovers diskutierten Aufsatz «Art and Objecthood» (1967) kritisiert wurde, sondern die Arbeit am Bild selbst, nun aber mit dem Blick und der Disposition einer Bildhauerin, bestimmte ihre Arbeit. Sie fotografiere, als ob sie eine «Figur modellieren würde», äusserte die Künstlerin im erwähnten Gespräch.
Die Ausstellung erinnert an die Begegnung zweier junger Menschen und deren gemeinsamer Interessen in einer lokalen Situation, welche das prozessuale, für internationale Entwicklungen offene künstlerische Schaffen begünstigte. Sie zeigt aber auch, wie unterschiedlich sich dieses geteilte Interesse an neuen Formen von Skulptur, die von den Künstlern selbst mit jenem an der eigenen Leiblichkeit und deren Erleben in Verbindung gebracht wurde, in der jeweiligen Arbeit manifestieren konnte. Das ist nicht nur das Wagnis dieser Ausstellung, sondern darin liegt auch ihre Bedeutung. Der Seifen-Raum ruft den abwesenden Körper und dessen Oberfläche, die Haut, mit theatralischen Mitteln auf. Die übertriebene Vervielfachung und Massierung der Seifen schaffen erst Raum für einen imaginären Körper. Der intensive, betörende Duft der im Raum verteilten Seifen, ihre Farbigkeit und die vertraute Form evozieren Intimität und Sinnlichkeit. Hannah Villiger zeigt ihren Körper aus einer selbst gewählten, schonungslosen Nähe und schafft zugleich Bilder, die, mit Ulrich Loock zu sprechen, «vollkommen unabhängig sind von den organischen Zusammenhängen imaginärer Identität. Die Haut des photographierten Körpers kehrt wieder als Bildoberfläche.» Diese durch eine absolute Nähe zu sich selbst erzeugte Distanz und Abstraktion, die mit dem Erfahrungsraum des Betrachters keine Form von Berührung aufweist, ist auch zugleich der Grund dafür, dass die Intimität des von der Künstlerin gewählten bildnerischen Verfahrens sich in der manifesten Körperlichkeit ihrer Bilder nicht mitteilt.
Roman Kurzmeyer
Jürg Stäuble wird am 1. Februar 1948 in Wohlen (Schweiz) geboren. Nach seiner Ausbildung zum Primarlehrer studiert er 1970-72 an der Schule für Gestaltung, Basel. 1988-2000 leitet er als Nachfolger von Johannes Burla die Fachklasse für freies räumliches Gestalten (Bildhauerfachklasse) an der Schule für Gestaltung, Basel. Mit der Gründung der Fachhochschule beider Basel im Jahre 2000 und jener der Fachhochschule Nordwestschweiz zwei Jahre später wird er zunächst Dozent an der Abteilung Bildende Kunst Medienkunst der HGK und dann Professor am Institut Kunst. In dieser Funktion lehrt er bis zu seiner Pensionierung im Jahre 2011. Seit 1992 wird der Künstler durch die Galerie Mark Müller (Zürich) vertreten. 2017 zeigt das Haus Konstruktiv in Zürich die Retrospektive «Jürg Stäuble – Mehr sein als System», zu der eine Werkmonografie erscheint. juergstaeuble.ch
Hannah Villiger wird am 9. Dezember 1951 in Cham (Schweiz) geboren. 1972-74 studiert sie an der Kunstgewerbeschule Luzern bei Anton Egloff in dessen Fachklasse für Bildnerisches Gestalten. 1992 erhält sie an der von Jürg Stäuble geleiteten Fachklasse für freies räumliches Gestalten (Bildhauerfachklasse) an der Schule für Gestaltung in Basel einen bis 1996 befristeten Lehrauftrag. Ab 1986 lebt sie in Paris, zuletzt zusammen mit Mouhamadou Mansour (Joe) Kébé und ihrem 1991 geborenen, gemeinsamen Sohn Yann. Hannah Villiger stirbt am 12. August 1997 in Auw (Schweiz). 2001 erscheint eine Monografie mit dem von Jolanda Bucher und Eric Hattan herausgegebenen Werkverzeichnis aller Fotoarbeiten von Hannah Villiger, welche die Retrospektive in der Kunsthalle Basel und im Bonner Kunstverein begleitet. hannahvilliger.com
«Wenn du unterrichtest und mit Studenten eine Arbeit entwickelst, an ihrem Schaffensprozess teilnimmst, bekommst du einen vollkommen anderen Blick für Arbeiten. Ein neues Auge öffnet sich und eine Neugier setzt ein, die Arbeit anderer entstehen zu sehen. Das Unterrichten hat meinen Blick und meine Beurteilung von Kunstwerken erweitert und verändert.» (Hannah Villiger, 1996)
Öffnungszeiten:
Samstag, 1. Dezember 2018, 14:00 – 18:00
Sonntag, 2. Dezember 2018, 14:00 – 18:00
Freitag, 7. Dezember 2018, 18:00 – 20:00
Samstag, 8. Dezember 2018, 14:00 – 18:00
Sonntag, 9. Dezember 2018, 14:00 – 18:00
Und nach Vereinbarung
info.kunst.hgk@fhnw.ch
Mit Dank an Patrick Doggweiler (Technik und Ausstellungsaufbau), Ana Domingez (Grafik), Eveline Wüthrich (Öffentlichkeitsarbeit) und Eric Hattan (The Estate of Hannah Villiger).
Interview
Roman Kurzmeyer im Gespräch mit Jürg Stäuble
RK: Jürg, du hast über viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen in Basel unterrichtet. Du hast die „Fachklasse für freies räumliches Gestalten“ geleitet und nach der Gründung der Hochschule für Gestaltung und Kunst am Institut Kunst gelehrt. Wann hast du die Fachklasse übernommen und was hast du angetroffen?
JS: Ich habe die Fachklasse 1988 von meinem Vorgänger Johannes Burla übernommen. Er trat damals in den Ruhestand. Die Stelle wurde ausgeschrieben und ich wurde in einem ordentlichen Auswahlverfahren als sein Nachfolger gewählt. Bereits vorher, seit 1982, war ich mit einigen wenigen Lektionen an der damaligen Schule für Gestaltung tätig, vorwiegend im räumlichen Bereich.
Die Fachklasse für freies räumliches Gestalten war eine Weiterbildungsklasse. Sie wurde „im Volksmund“ Bildhauerfachklasse genannt. Die Ausbildung dauerte nur zwei Jahre.
Der Übergang von Burla zu mir war anfangs nicht ganz einfach. Ich wollte gewisse Änderungen, etwas mehr Struktur in die Ausbildung einbringen. Die Bildhauer waren zu diesem Zeitpunkt (seit etwa zwei, drei Jahren) im Untergeschoss des Baerwart Schulhauses untergebracht. Es war eine recht autonome Gruppe von Individuen. Die Studierenden sind so ziemlich gekommen und gegangen wie sie gerade wollten. Es gab wenig Verbindlichkeit und Struktur. Ich wollte wöchentliche Treffs für gemeinsame Arbeitsbesprechungen, Diskussionsrunden und Seminare installieren und die Atelierarbeit durch sporadische individuelle Arbeitsbesprechungen und technischen Support begleiten. Es brauchte eine Weile, eine verbindlichere Struktur zu etablieren. Es gab natürlich bereits unter der Leitung von Johannes Burla vergleichbare Angebote, allerdings auf einer spontaneren, zufälligeren und eben unverbindlicheren Ebene. Auch das hat natürlich eine gewisse Qualität.
Das Studium sah in den Anfangsjahren etwa folgendermassen aus:
- Hauptgewicht hatte selbstverständlich die individuelle künstlerische Arbeit mit Atelierarbeit und Werkstatt.
- Wöchentlich gab es ein Treffen mit allen Studierenden für gemeinsame Arbeitsbesprechungen, Ausstellungsbesuche oder Diskussionsrunden über selbst gewählte Fragestellungen.
- Zudem gab es wöchentlich ein Seminar über Philosophie oder Kunstgeschichte, Literatur, Ethik, Architektur, ... . Dazu wurden semesterweise verschiedene Dozierende eingeladen wie z.B. Hans Saner, Reinhard Storz, Birgit Kempker, Prof. Hanspeter Schreiber, Dominique Salathé, ... .
- Einmal jährlich (später einmal pro Semester) gab es Studienwochen mit eingeladenen Gästen, meist Künstlerinnen und Künstlern, z.B. Till Velten, Claudia und Julia Müller, Joseph Felix Müller, Hannes Brunner, Muda Mathis, .... .
- Von Zeit zu Zeit gab es auch Projekte, meist auf Anfrage von aussen. Oft handelte es sich um Kunst im öffentlichen Raum oder Kunst und Bau.
- Ende Studienjahr haben wir jeweils eine öffentliche Ausstellung durchgeführt, wo wir Gäste, KünstlerInnen oder VermittlerInnen zur Kritik eingeladen haben.
- Sehr wichtig war auch, dass ich regelmässig einen zweiten Künstler, eine zweite Künstlerin quasi als Gegenpart zu mir, zuziehen konnte. Das war während den ersten 4 Jahren Guido Nussbaum. Mit ihm habe ich das Programm erarbeitet und gestaltet. Später war es dann Hannah Villiger und noch später Muda Mathis.
RK: Hast du bewusst keinen Bildhauer als Mitarbeiter eingestellt?
JS: Ja schon. Ich wünschte mir MitarbeiterInnen, welche einen gewissen Gegenpol zu mir darstellten sowohl im Medialen als auch von ihrer Persönlichkeit her. Räumliche Fragestellungen waren aber sowohl in der Arbeitsweise von Guido Nussbaum, als auch von Hannah Villiger und Muda Mathis von grosser Bedeutung. Mir erschien es wichtig, dass die Studierenden mit unterschiedlichen Meinungen und Haltungen konfrontiert werden.
RK: Gab es neben dir und dem zweiten Dozenten auch technische Mitarbeiter?
JS: Ja, von Johannes Burla hatte ich Andy Spichty übernommen. Er war für die Werkstätten zuständig. Er war oft an der Schule und hat den Studierenden beim Realisieren von Arbeiten geholfen sei es in Holz, Metall, Kunststoff oder andern Materialien. Er war ein guter Allrounder und unterstützte die Studierenden in der konkreten Planung und Umsetzung von Projekten. Er war unverzichtbar. Er bot auch Einführungskurse in verschiedenen Techniken an. Später haben wir auf Wunsch der Studierenden noch weitere Fächer installiert wie z.B. Modellieren, anfangs mit Helen Ballmer und später mit Matthias Frey. Wir hatten natürlich nicht beliebig viele Lektionen zur Verfügung. Wir mussten immer wieder Gesuche beim Direktor einreichen bzw. bei ihm vorsprechen. Gewisse Fächer oder Schwerpunkte wechselten nach Bedarf der Studierenden von Zeit zu Zeit. Da gab’s mal ein philosophisches Seminar, mal ein kunsthistorisches, mal was über Architektur usw.
RK: Welche Lehrinhalte waren dir wichtig, als du 1988 die Leitung der Bildhauerklasse übernommen hast, und haben sich diese Schwerpunkte während deiner langen Lehrtätigkeit verändert?
JS: Anfangs war der Fokus sicher primär auf die künstlerische Praxis gerichtet. Wie findet man zu einer individuellen künstlerischen Sprache? Wie können Ideen und Anliegen adäquat umgesetzt werden? Feedbacks von uns Dozierenden und von den Mitstudierenden sollten dabei helfen, die eigene Position zu hinterfragen und zu klären. Für die Umsetzung standen die Werkstätten und das technische Knowhow der Dozierenden zur Verfügung. In verschiedenen Seminaren wurde eine kunst-und kulturhistorische Basis zu vermitteln versucht.
Später, im Kontext mit der Umwandlung zur Fachhochschule rückte die theoretische und reflektierende Ebene vermehrt ins Zentrum. Kunsttheorie, Kunstvermittlung, Philosophie und soziokulturelle Fragestellungen erhielten einen höheren Stellenwert und wurden umfassender und systematischer vermittelt
RK: Zunächst gab es drei unabhängige Fachklassen mit eigenem Lehrangebot?
JS: Ja richtig. Es gab Fachklassen für Malerei, Bildhauerei und Video. Man hat gegenseitig immer etwa mitbekommen, was die andern gerade so am Machen waren. Das war anregend. Mit der Zeit entstanden vermehrt auch Berührungspunkte und Überschneidungen. Es kam vor, dass Studierende der Bildhauerklasse an einem Seminar der Maler teilnahmen und umgekehrt. Studierende der Malklasse beteiligten sich an Projekten der Bildhauer oder konnten unsere Werkstätten benutzen. Wir hatten einen relativ grossen Handlungsspielraum.
RK: Diese individuelle Praxis, war die geleitet von einer bestimmten Vorstellung deinerseits, was für Kunst in deiner Klasse entstehen sollte?
JS: Mir war es immer ein Anliegen unterschiedlichen Haltungen Raum zu bieten. Das war auch der Grund, weswegen ich alle paar Jahre einen andern Mitdozenten engagiert habe. Guido Nussbaum, Hannah Villiger und Muda Mathis haben je ganz unterschiedliche Aspekte in die Schule eingebracht. Das war auch für mich sehr anregend. Den Studierenden wollte ich stilistisch und thematisch möglichst keine Vorgaben machen. Bei mir konnte jemand figurativ arbeiten, abstrakt, geometrisch oder konzeptionell. Es war mir primär ein Anliegen, dass die Studierenden sich mit Fragestellungen befassten, die sie ganz persönlich beschäftigten und interessierten. Ob das schliesslich zu politischer Kunst oder ganz individualistischer Kunst führte, das war mir eigentlich egal. Letztendlich kam es vor allem darauf an möglichst adäquate Mittel einzusetzen und eine Idee zum Tragen zu bringen. Darüber konnte man diskutieren und streiten. Das führte zu spannenden Auseinandersetzungen und man musste sich dabei auch nicht immer einig werden.
RK: Und der Ausgangspunkt für diese Gespräche, das war die einzelne Arbeit? Wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Wurden die Kunstvorschläge der Studierenden untereinander diskutiert?
JS: Das konnte eine einzelne Arbeit sein, eine Werkgruppe, vielleicht auch nur ein Konzept oder eine Idee. Oft waren diese Gespräche ja auch schwierig. Oft musste man auch etwas Druck ausüben, damit sich die Studierenden dieser Auseinandersetzung stellten und sich exponierten.
Wir wollten selbstverständlich aber nicht nur über die Kunstvorschläge der Studierenden sprechen. Genau so wichtig waren Ausstellungsbesuche oder Präsentationen über Künstlerinnen und Künstler. Auch dadurch konnte die eigene Haltung überprüft und die eigene Position geklärt werden. Auch die Textarbeiten, welche die Studierenden jährlich zu verfassen hatten, flossen in diese Gesprächs- und Diskussionsrunden ein.
RK: Haben sich die Erwartungen der Studierenden an die Ausbildung im Verlauf deiner Lehrtätigkeit verändert?
JS: Ja, das hat sich teilweise schon verändert. Am Anfang waren die drei Kunstklassen Weiterbildungsklassen und dauerten nur zwei Jahre. Wir konnten sie dann zwar bald auf drei Jahre verlängern. Nicht alle Studierenden kamen direkt von der Schule zu uns. Einige waren schon um die 30 oder 40 Jahre alt und wollten sich neu orientieren. Sie bewarben sich spät, weil sie zuvor, sei es durch Beruf oder familiäre Umstände, nicht die Möglichkeit hatten, zu studieren. Ihnen konnte oft ein neues Feld eröffnet werden. Damals war die Maturität, Fach- oder Berufsmaturität noch nicht vorausgesetzt. Von daher hatten wir eine wirklich bunte Mischung von Leuten. Der Kunstbetrieb stand noch viel weniger im Fokus. Es war noch viel mehr ein Ausloten, Experimentieren, eine Art Selbstfindung mit der Perspektive, sich später allenfalls als KünstlerIn zu behaupten.
Heute kommen viele Studierende direkt ab Matur. Sie sind im Schnitt um einiges jünger und weisen oft noch ein typisches „Schülerverhalten“ auf. Die Auseinandersetzung mit dem Kunstbetrieb ist heute ebenso zentral wie die Entwicklung einer persönlichen künstlerischen Haltung.
RK: Welche Orte in der Stadt waren wichtig für den Unterricht?
JS: Wir haben relativ oft Ausstellungen im Raum Basel besucht. In der Kunsthalle, im Kunstmuseum, in Galerien, z.B. bei Stampas und in alternativen Kunsträumen wie der Filiale. Wir machten hie und da auch Atelierbesuche. Auch die Auseinandersetzung mit dem Stadtraum war von Bedeutung. Wir besuchten immer wieder auch andere Städte.
RK: Und die Studienreisen ....
JS: Fast regelmässig besuchten wir die Biennale von Venedig, die Documenta in Kassel oder die Skulptur Projekte in Münster, später auch die Istanbul Biennale. Wir besuchten auch Städte oder Gegenden aus andern Gründen, z.B. Porto wegen der Architektur oder Warschau, Wien oder das Ruhrgebiet.
RK: Gab es auch Formen der Zusammenarbeit mit Museen oder Galerien?
JS: Das war eher selten der Fall. Wir haben aber unzählige eigene Projekte initiiert und wurden von diversen Institutionen zur Zusammenarbeit eingeladen. Wir realisierten Ausstellungen, Performances und Kunst im öffentlichen Raum. Da waren einige recht aufwändige Projekte darunter. Teilweise waren sie in Studienwochen mit eingeladenen Gästen eingebettet. Ich will nur einige wenige davon erwähnen.
- Eines der frühen Projekte (1994/95) wurde von Till Velten initiiert. Es hiess das Hotel. Wir konnten zusammen mit eingeladenen Kunstschaffenden ein altes Seehotel in Domburg NL mit raumspezifischen Arbeiten bespielen. Parallel dazu entstand eine Grafikmappe und im Kunstverein Middleburg wurden Modelle zum Hotelprojekt gezeigt. - Ein weiteres Grossprojekt hiess Kunst und Alltag (2000) . Es wurde begleitet von Seminaren, Vorlesungen und praxisorientierten Workshops. Es führte schliesslich zu ortsspezifischen Projekten in Form von Malerei, Skulptur, Installation, Foto, Film, Video, Performance und Aktionen. Das Projekt fand im ehemaligen U-Shop des Bahnhofs SBB statt, bevor dieser umgebaut wurde.
- Zusammen mit der Kunstabteilung der ECAV in Sierre führten wir im Goms einen zweiwöchigen Workshop unter dem Titel Querfeldein (2008) durch. Daraus ist eine Ausstellung im Landschaftsraum und eine tolle Publikation in 2 Bänden entstanden.
- Kunst und Bau Projekte sind unter anderem im Alters- und Pflegeheim Marienhaus in Basel (1996/97) realisiert worden.
- Zweimal wurden wir an die CAR Contemporary Art Ruhr (2009) eingeladen. Daraus ergab sich später eine Ausstellung im Kunstverein Duisburg (2011).
- Nicht vergessen sollte man all die Projekte, die durch die Studierenden selbst initiiert worden sind, z.B. die Versicherung (1997) beim Heuwaage Viadukt oder der Schalter, ein von Studierenden betriebener Ausstellungsraum im Kleinbasel.
Es gäbe noch viele weitere Projekte zu erwähnen.
RK: Die Orientierung war regional?
JS: Nein, nicht unbedingt. Nebst Projekten im regionalen und schweizerischen Umfeld fanden auch Projekte in Holland, Berlin, Essen, Kassel, Duisburg, ... statt.
RK: Gab es auch Gastkritiker, die nicht zur Schweizer Kunstszene gehörten?
JS: Anfangs waren die Gäste für Workshops und für die Kritik an den Jahres- und Diplomausstellungen vorwiegend aus der Schweiz, später haben wir dann immer öfter auch KünstlerInnen oder KunstvermittlerInnen aus dem Ausland eingeladen, Till Velten, Katharina Grosse, Leni Hoffmann, Axel Lieber, Monika Brandmeier, ... . Die Einladungen sind meist über persönliche Kontakte entstanden.
RK: Mit der Neuorganisation des Instituts innerhalb der Fachhochschule wurdest du in eine grössere Struktur eingebunden, die auch eine andere Form von Organisation nach sich zog. Wie hast du diese Zeit erlebt?
JS: Anfangs waren die Bildhauer, die Maler und die Videofachklasse getrennt voneinander. Sie hatten je ihr eigenes Programm, ihre eigenen Ateliers und ihre eigene Infrastruktur. Immer öfter zeigte sich das Bedürfnis von unsern Studierenden z.B. auch mal ein Video zu machen. Ich verstand mich selber auch nicht als «Bildhauer Bildhauer». Guido Nussbaum setzte in seiner Arbeit sowohl Malerei, Skulptur als auch Video ein. Hannah Villiger verstand ihre Fotografie als Skulptur und Muda Mathis bewegte sich zwischen Video, Performance, Installation und Musik. So wurden die medialen Grenzen nach und nach aufgeweicht. Irgendwann haben wir uns eine Videokamera angeschafft, und später einen Computer. Von unseren Studierenden bestand das Bedürfnis, die Infrastruktur der Videofachklasse benutzen zu können und unsere Werkstatt wurde mehr und mehr von Studierenden der andern Fachklassen in Anspruch genommen. Die Aufteilung in verschiedene Medien wurde immer mehr obsolet. Die Grenzen zwischen den Fachbereichen wurden immer fliessender. Als Erstes organisierten wir die jährlichen Ausstellungen und Schlussbesprechungen gemeinsam. Wir initiierten vermehrt Projekte an denen sich alle Studierenden beteiligen konnten. Die Trennung zwischen den einzelnen Fachbereichen aufzubrechen, war mir ein grosses Anliegen. Mit der geplanten Neuorganisation im Rahmen der Fachhochschule drängte sich die Zusammenführung der drei Fachklassen zu einer Kunstklasse quasi auf. In diesem Sinne versuchten wir neue Modelle zu entwickeln.
RK: Und diese Modelle waren Visionen? Grosse Entwürfe, die sich als nicht realisierbar erwiesen haben oder konnte verwirklicht werden, was sich das Team in der Entwicklungsphase vorgenommen hatte?
JS: Ich hätte mir diese Transformation als fliessenderen, kontinuierlicheren Prozess gewünscht. Wir waren eigentlich auf gutem Weg. Das Überdenken von Inhalten und Erarbeiten von neuen Formen hätte ein spannender Prozess werden können. Doch uns wurde aufgetragen unsere Inhalte in eine unpassende Struktur, welche gleichermassen für Wirtschaft, Technik, soziale Arbeit, ... und Kunst Gültigkeit haben sollte, einzubetten. Wir wurden von einem Coach durch diesen Prozess gepeitscht und haben dabei vor allem für den Papierkorb gearbeitet. Das fand ich eine total mühsame Phase.
RK: Aber gibt es denn etwas ganz Konkretes, was du benennen könntest, was ihr euch erträumt habt, was nicht realisiert worden ist durch dieses neue Institut? Vielleicht auf der Ebene was für Studierende man anspricht oder auf der Ebene was für eine Art Atmosphäre an der Schule geschaffen werden sollte? Oder vielleicht auch was die Zielsetzung der Ausbildung anbelangt? Also was für eine Art Künstler aus dem Institut hervorgehen soll?
JS: Der ganzheitliche Ansatz drohte verloren zu gehen. Kunstpraxis, Theorie und Technik wurden mehr und mehr in einzelne Lehrveranstaltungen aufgeteilt. Das führte zu einer totalen Aufsplitterung und Überfrachtung des Curriculums. Das ist bei den Studierenden verständlicherweise nicht gut angekommen. Wir mussten bereits im ersten Jahr Korrekturen anbringen. Mit Erfindungsreichtum und List versuchten wir Bewährtes in die neue Struktur, in den neuen Lehrplan hinüber zu retten.
Uns war es wichtig, eine „umfassende“ Kunstausbildung anzubieten. Die Studierenden sollten Zugang zu allen künstlerischen Medien haben. Sie sollten über solide Grundkenntnisse in Kunsttheorie, Kunstgeschichte und Philosophie verfügen. Auch in Fragen zum Kunstbetrieb und zum Kunstmarkt sollten sie sich auskennen. Eine ausgeglichene Balance zwischen künstlerischer Praxis, Technik, Reflexion und Theorie war unser Ziel. Das ist natürlich in einem gewissen Sinne eine Überforderung. Zusammenhänge zu schaffen und eine Balance zu finden zwischen diesen Ansprüchen ist eine grosse Herausforderung die sich immer wieder von neuem stellt.
RK: Welches waren von heute aus gesehen die Stärken in deiner Lehre?
JS: Eine meiner Stärken war wohl, dass ich den Studierenden viel Raum gegeben habe, um sich zu finden und eigene Ideen zu entwickeln. Ich habe sie dort abzuholen versucht, wo sie gerade stehen. Von dort aus versuchte ich sie zu fordern und zu fördern. Die unmittelbare Wahrnehmung war mir dabei besonders wichtig. Im Gespräch versuchte ich das, was ich sehe, mit dem was ich höre, mit Absichtserklärungen und Fragen, in Relation zu setzen. Daraus entwickelten sich oft spannende Dialoge. Das war mir sowohl in Einzelgesprächen als auch in gemeinsamen Arbeitsbesprechungen wichtig. Ein grosses Anliegen war mir auch unter den Studierenden und Dozierenden ein anregendes und gutgesinntes Klima zu schaffen. Es ist mir auch gelungen, viele Studierende zur Teilnahme an Projekte zu motivieren. Sie haben sich meist mit grossem Interesse und Engagement daran beteiligt. Für viele war es eine der ersten Möglichkeiten, an die Öffentlichkeit zu treten und entsprechende Erfahrungen zu sammeln. Diese Art von Praxisbezug finde ich unverzichtbar im Rahmen einer Kunstausbildung.
RK: Konntest du aus dem Unterrichten auch für deine eigene künstlerische Arbeit etwas mitnehmen? War das Unterrichten anregend und wie hat es sich auf deine eigene Praxis ausgewirkt?
JS: Ich habe grundsätzlich sehr gerne unterrichtet. Die Lehrtätigkeit brachte aber auch gewisse Zeitprobleme mit sich. Ich hatte meist ein Pensum von etwa 60% an der Schule. Parallel dazu war ich an Ausstellungen und Kunst und Bau Projekten beteiligt. Manchmal erreichte ich annähernd die Grenzen von dem, was ich zu leisten imstande war. Profitiert habe ich sehr vom laufenden Diskurs über Kunst und Gesellschaft. Viele Fragen über das eigene Selbstverständnis als Künstler und den Sinn von Kunst wurden aufgeworfen. So habe ich auch von Gesprächsrunden in unseren Foren und von Vorträgen im Guest Corner profitiert. Auch Kontakte zu Studierenden und ehemalige Studierende haben mir sehr viel gebracht und sind mir teils bis heute geblieben. Anregungen durch die Lehrtätigkeit, welche sich direkt auf meine künstlerische Arbeit ausgewirkt haben, gab es jedoch weniger.
RK: Worin hat sich das Institut Kunst von anderen Schulen des In- und Auslandes zu deiner Zeit unterschieden?
JS: Unter den Schulen in der Schweiz gab es sicher viel Vergleichbares. Sie unterschieden sich teilweise in der Schwerpunktsetzung. Im Lauf der Jahre sind in der Schweiz einige neue Studiengänge hinzugekommen. Der einsetzende Fachhochschulprozess führte zu laufenden Veränderungen. Luzern zeichnete sich anfangs durch seine guten Werkstätten und den Fokus auf Bildhauerei aus. Zürich als neue Schule legte grossen Wert auf Kunsttheorie und Basel profilierte sich durch das breite Angebot von Malerei, Skulptur und Video. Basel hatte auch einen guten Ruf, was das Lernklima, die Atmosphäre anbelangt. Basel galt als familiär und offen. Genf war wie eine Akademie organisiert und wurde durch Künstlerpersönlichkeiten wie Claude Sandoz, Carmen Perrin, Silvie und Chérif Defraoui geprägt. Die Schulen wurden durch die Fachhochschulentwicklung verändert. Wo die Schulen heute in diesem Prozess stehen, weiss ich im Einzelnen nicht. Die deutschen Akademien haben sich der Bologna Reform ja weitgehend widersetzt. Vielleicht wäre das auch für die Schweiz eine Option gewesen. Dazu waren aber unsere Kunstabteilungen zu klein und die Idee einer grossen überregionalen Kunsthochschule hätte wohl kaum eine Chance gehabt. Zu wichtig sind für die grösseren Städte eigene Kunsthochschulen, denn sie tragen viel zum kulturellen Klima einer Region bei.
RK: Vielen Dank, Jürg!